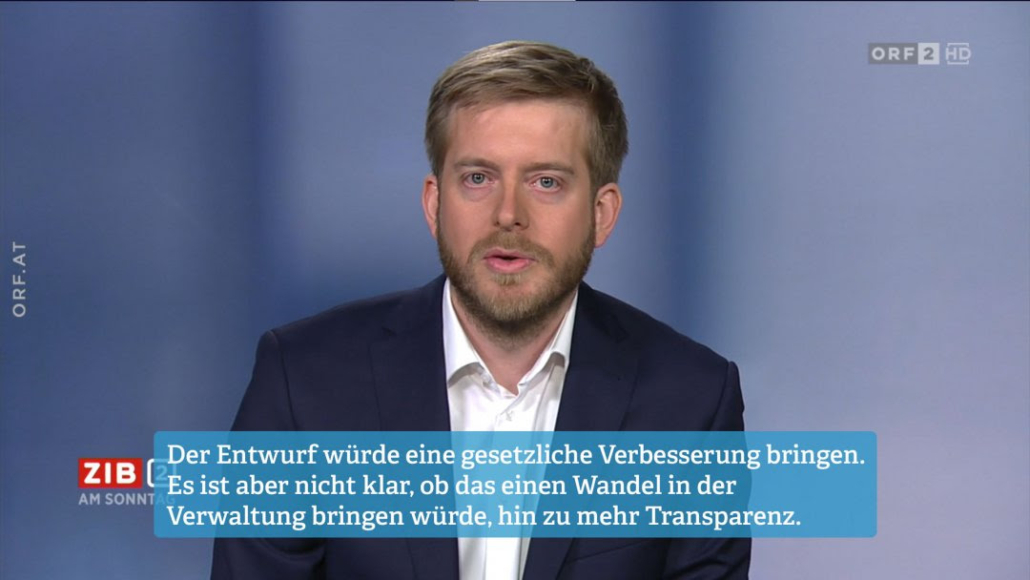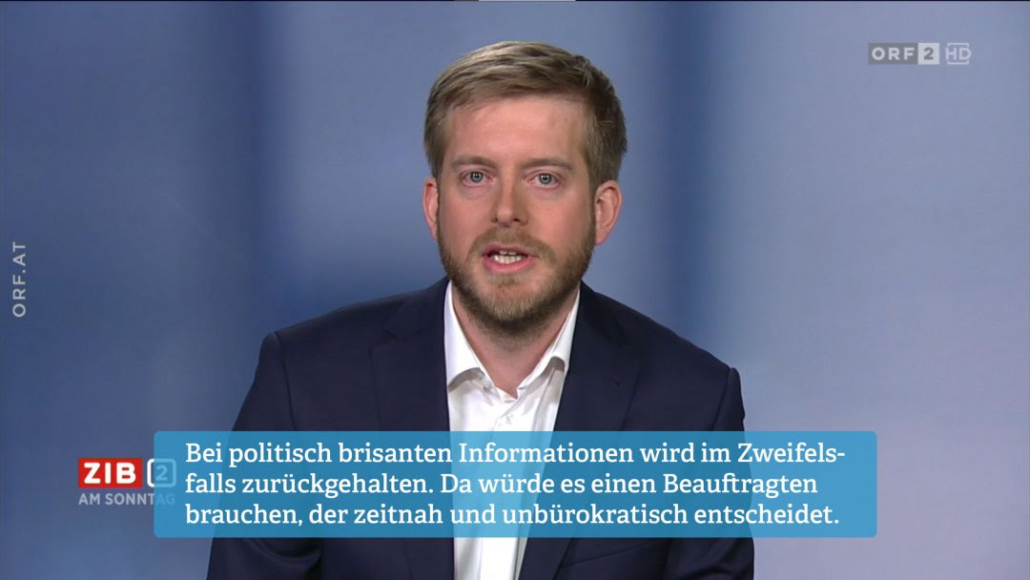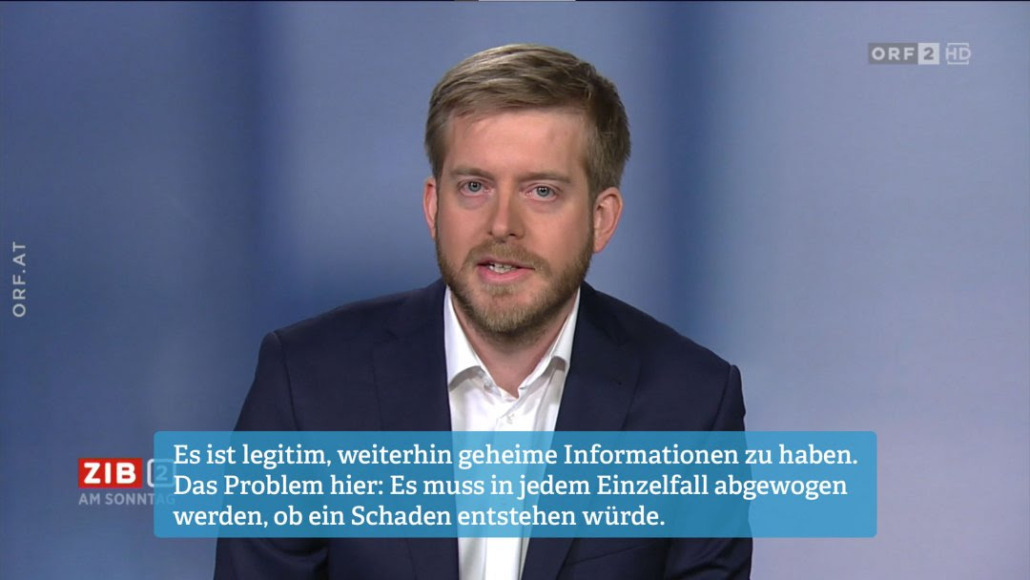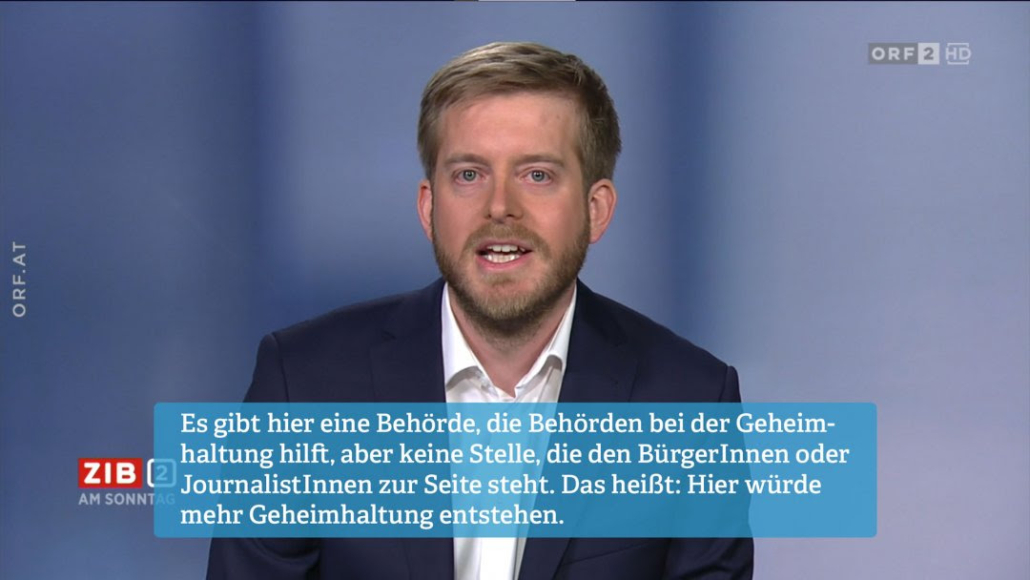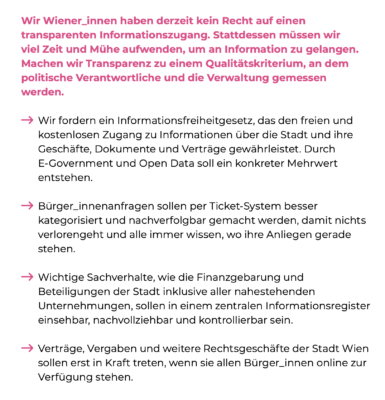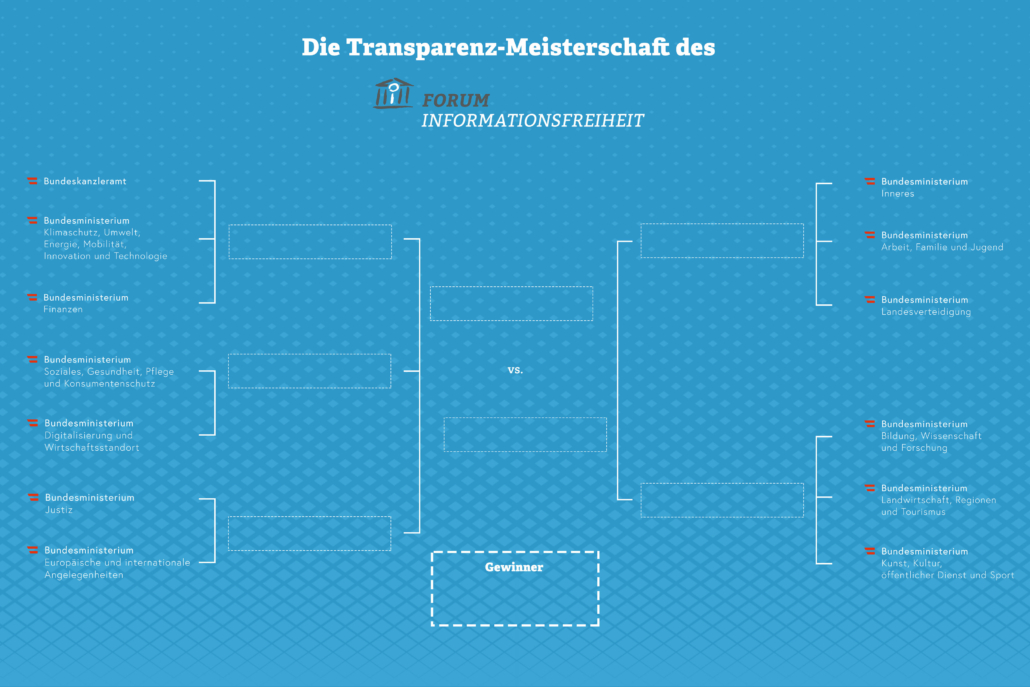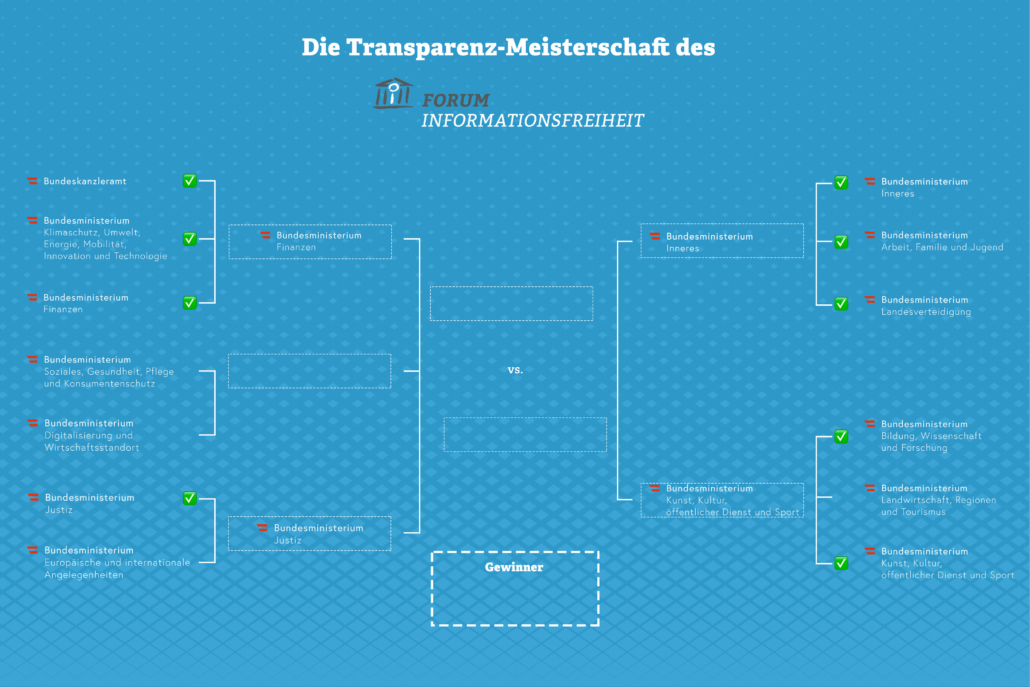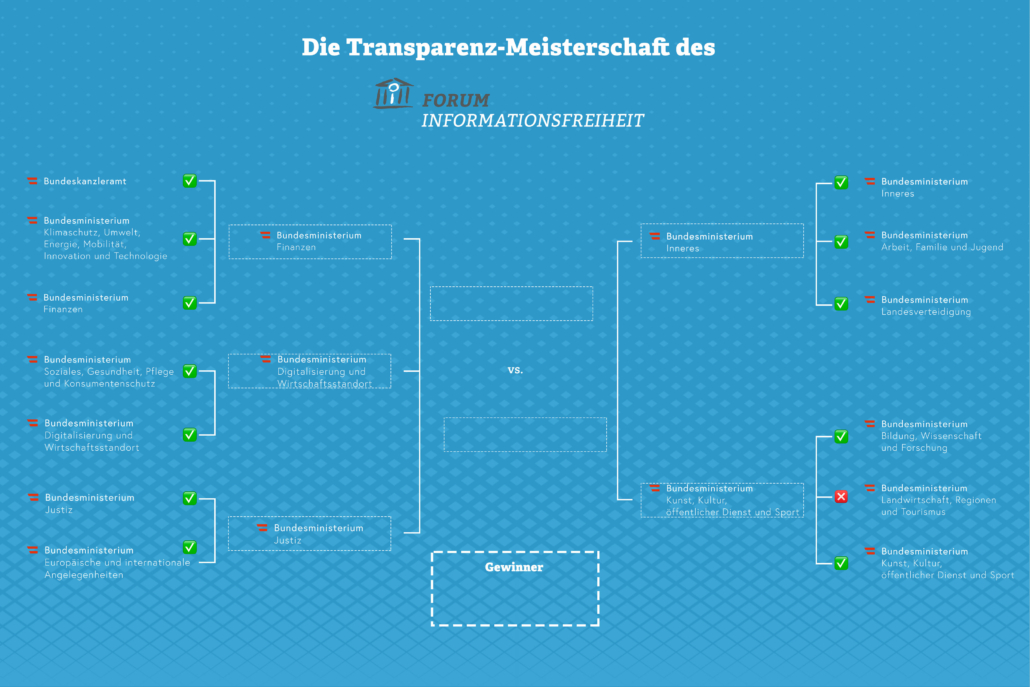Korruptionsaffäre: Transparenz-NGO fordert Löschverbot für Handys von Amtsträgern der Republik
Forum Informationsfreiheit fordert volle Aufklärung und umfassende Transparenzregeln:
- Dokumentationsgesetz soll Amtsträger zu beruflichen Kommunikationsgeräten verpflichten und das Löschen von Nachrichten unter Strafe stellen
- Beschluss eines effektiven Informationsfreiheitsgesetzes darüber hinaus nun Gebot der Stunde
WIEN – Das Forum Informationsfreiheit (FOI) ortet dringenden Handlungsbedarf für schärfere Transparenzgesetze: Berichte über mutmaßlich missbräuchliche Verwendung von Steuergeld für persönliche und parteipolitische Zwecke müssten bei den Verantwortlichen alle Alarmglocken schrillen lassen. Das FOI fordert daher nicht nur volle Aufklärung der bisherigen Vorgänge, sondern vor allem umfassende Transparenzregeln für die Zukunft.
Nachdem erste politische Konsequenzen gezogen wurden, sei es nun das Gebot der Stunde, ein effektives Informationsfreiheitsgesetz zu beschließen, das den Namen auch verdiene. „Es gilt nicht nur, Amtsmissbrauch und Korruption in Zukunft zu verhindern, sondern auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Politik und Verwaltung zurückzugewinnen. Das geht nur mit echter Transparenz und echter öffentlicher Kontrolle”, sagt Mathias Huter, Vorstand des Forum Informationsfreiheit.
Darüber hinaus fordert das Forum Informationsfreiheit ein neues Dokumentationsgesetz, das Amtsträger der Republik zu beruflichen Kommunikationsgeräten verpflichtet und das Löschen von Nachrichten auf offiziellen Geräten und Kanälen unter Strafe stellt.
„Wenn eine solche Affäre erst fünf Jahre später bekannt wird, und dann nur durch einen Zufallsfund, zeigt das, wie sehr es Reformen braucht, um Machtmissbrauch effektiv zu verhindern“, so Mathias Huter.
Politische Verantwortung darf nicht verschleiert werden können
Mit der Kommunikation über Handys werde immer mehr Macht ausgeübt und damit Fakten geschaffen: Staatliches Handeln müsse dabei nachvollziehbar bleiben, Entscheidungsprozesse von Amtsträgern im Nachhinein rekonstruierbar sein, um die politische Verantwortung klären zu können.
Die Nichtlieferung von Akten und das Zurückhalten von Emails von Ministern im U-Ausschuss sowie die Nutzung privater Handys durch den ehemaligen Bundeskanzler hätten gezeigt, wie die Kontrollfunktion des Parlaments durch die Regierung konterkariert werden kann.
Diensthandys kein rechtsfreier Raum
Es könne nicht sein, dass die Republik mit den geschaffenen Fakten leben müsste, aber die politisch Verantwortlichen ihre Spuren verwischen könnten, und sich damit ihrer Verantwortung entledigen. Daten von Diensthandys müssten genauso gesichert werden, wie alle anderen Kommunikationsdaten der Ministerien auch, damit die Kontrollfunktion wahrgenommen werden kann. Denn Diensthandys dürfen kein rechtsfreier Raum sein. Das gelte auch für Handys und Mails von Kabinettsmitarbeitern.
„Um Missbrauch und Korruption in Zukunft so weit wie möglich zu erschweren und zu verhindern, braucht es einen Paradigmenwechsel. Wo es Macht gibt, braucht es Transparenz um Kontrolle sicherzustellen. Das lässt sich nur mit einer lückenlosen Dokumentation und Archivierung der beruflichen Kommunikation von Amtsträgern gewährleisten“, sagt Huter.
Löschverbote in anderen Staaten bereits verankert
Eine rasche Umsetzung eines starken Transparenzgesetzes würde öffentliche Kontrolle ermöglichen und den Missbrauch von öffentlichen Geldern und anvertrauter Macht verhindern, da sich das Risiko für die Beteiligten, ertappt zu werden, massiv erhöhen würde.
In anderen Ländern sei man da bereits weiter: In Deutschland wurde die Debatte bereits im vergangenen Jahr begonnen, in Irland wurden Ermittlungen gegen einen Minister nach einer Löschung gestartet – und englischsprachige Staaten wie die USA oder Neuseeland hätten schon lange klare Löschverbote in ihren Gesetzen.
Auto-Burn-Funktionen absolutes No-Go, Kontrollstelle soll Ausnahmen genehmigen
Ein Transparenzgesetz wie das Informationsfreiheitsgesetz kann jedoch keine Nachvollziehbarkeit sicherstellen, wenn Amtsträger ihre Kommunikation über private Handys und Email-Konten führen dürfen, und Daten einfach ohne Konsequenzen vernichten können.
Vor allem Messenger-Apps oder Software mit “Auto-Burn”-Funktion, wie sie zuletzt in Ministerien angeschafft oder angedacht worden sein sollen, seien daher ein absolutes No-Go im Verwaltungsbereich. Auch das Löschen beruflicher Terminkalender dürfe es in Zukunft nicht mehr geben, so FOI-Vorstand Mathias Huter.
Derzeit überlasse das Archivgesetz dem Personal in Behörden die Entscheidung, ob ihre eigene Kommunikation zu archivieren sei. “Kommunikation wird in der Regel nur archiviert, wenn sie einem bestimmten Akt zugeordnet wird“, so FOI-Vorstandsmitglied Markus Hametner. „Das muss in Zukunft anders sein: Löschungen dürften nur in Ausnahmefällen erfolgen, und müssten bei einer eigenen Stelle explizit beantragt und genehmigt werden“.
Wichtiger Nebeneffekt: Ein Verbot, das private Smartphone für Republiks-Angelegenheiten zu nutzen, sei schon im Sinne der Informationssicherheit staatlicher Information wichtig.
Rückfragehinweis:
Mathias Huter,
Vorsitzender, Forum Informationsfreiheit
mathias.huter@informationsfreiheit.at
+43 699 126 39 244