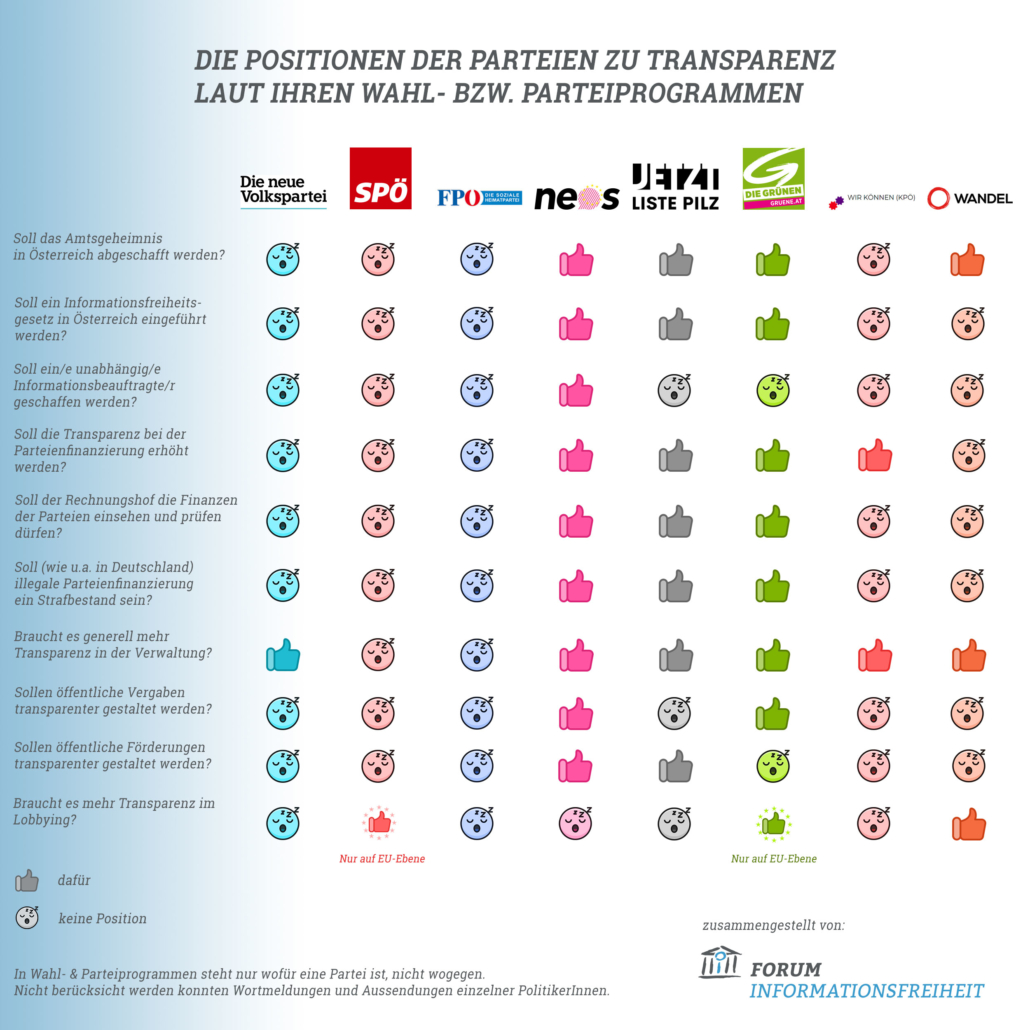Nominierungen für die “Mauer des Schweigens” 2020: Shortlist
Anlässlich des internationalen Tags der Informationsfreiheit – dem Right to Know-Day am 28. September – verleiht das Forum Informationsfreiheit seit 2014 den Amtsgeheimnis-Award „Die Mauer des Schweigens“ für “besondere Verdienste um die Verweigerung amtlicher Antworten”.
Mit dem Negativ-Preis weisen wir jährlich auf die inakzeptable Praxis der Geheimhaltung von Informationen öffentlichen Interesses vor den Bürgerinnen und Bürgern hin.
Nominiert werden konnten alle Fälle bei denen österreichische Behörden Auskünfte verweigert haben, Informationen von Politik oder Verwaltung zurückgehalten wurden, oder öffentliche Kontrolle staatlicher Institutionen durch politische Bemühungen erschwert oder verhindert wurde.
Shortlist:
Gesundheitsministerium und -behörden
„Für das Transparenz-Multiorganversagen rund um die Daten der Corona-Pandemie und Corona-Ampel“
Seit Beginn der Corona-Krise werden regelmäßig Entscheidungsgrundlagen der Behörden verschwiegen und Informationen über die Arbeit der Gesundheitsbehörden geheim gehalten. Insbesondere wird beispielsweise nicht veröffentlicht, wie lange die Gesundheitsbehörden benötigen, um Fälle nachzuverfolgen oder Verdachtsfälle zu testen. Diese Zahlen, die auch für die Festlegung der Corona-Ampel verwendet werden, werden weiterhin geheim gehalten oder nur selten oder – wenn überhaupt – vereinzelt kommuniziert.
Ein Sinnbild für die Transparenz-Bemühungen des Gesundheitsministers fand sich auch in der Pressekonferenz, bei der die Corona-Ampel vorgestellt wurde. Wiederholt wurde betont, dass diese Maßnahme Transparenz und faktenbasierte Entscheidungen bringen werde. Fragen nach den Schwellwerten, bei deren Überschreitung in der Kommission über die Ampelfarben „Orange“ und „Rot“ diskutiert werden wird, wurden jedoch nicht beantwortet.
Das sind leider nur einige Beispiele. Weitere Transparenz-Versäumnisse im Schnelldurchlauf:
- Die Protokolle der „Taskforce Corona“ wurden wochenlang geheim gehalten, Stand Ende September sind nur die ersten 11 Protokolle öffentlich.
- Zahlen zu bestätigten Fällen in den Gemeinden findet man – außer in Vorarlberg und Tirol, wo eigene Dashboards dafür geschaffen wurden – zwar in einzelnen Gemeindezeitungen, Anfragen danach werden jedoch mit dem Argument „Datenschutz“ abgelehnt (obwohl die Dashboards der Länder Tirol und Vorarlberg zeigen, dass eine Veröffentlichung problemlos möglich wäre).
- Zahlen zu den Wiener Gemeindebezirken werden zwar vereinzelt durch Leaks öffentlich, jedoch nicht strukturiert und auf Anfrage.
- Selbst eindeutige Antwort- und Bescheidfristen wurden vom Gesundheitsministerium bei Auskunftsbegehren nicht beachtet [siehe Addendum-Zeitung, Ausgabe 16, @jawei].
- Probleme bei der Datenveröffentlichung wie fehlende Zeitreihen oder inkonsistente Definitionen.
- Keine oder nur besonders kurze Begutachtungsfristen bei wichtigen Gesetzesvorlagen zu Gesundheits- und Grundrechtsfragen.
Finanz- & Infrastrukturministerium: die geheime €450-Millionen Rettung der Austrian Airlines
“Hunderte Millionen Euro Steuergeld für eine private Fluglinie – ohne Transparenz und öffentliche Kontrolle”
Mit einem Zuschuss von 150 Millionen Euro Steuergeld sowie bis zu 300 Millionen Euro an staatlich besicherten Krediten hat die Republik Österreich im Juni die Fluglinie Austrian Airlines AG, die der Lufthansa gehört, gerettet.
Das Rettungspaket wurde auf einer Pressekonferenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler präsentiert. Doch die Details abseits des politischen Spins bleiben geheim.
Auf ein Auskunftsbegehren nach dem Inhalt des Rettungsvertrages – interessant wäre etwa, ob sich das Management des geretteten Unternehmens Boni auszahlen lassen kann – verneinten sowohl Finanzministerium als auch das Infrastrukturministerium jegliche Zuständigkeit. Beide Minister sprachen jedoch bei der Pressekonferenz ausführlich zur AUA-Rettung. Vertragspartner in der AUA-Rettung seien die bundeseigene Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) bzw. die staatliche COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG). Deshalb könne man keine Auskunft gewähren. Beide staatlichen Unternehmen liegen laut Ansicht der Ministerien außerhalb des Anwendungsbereichs des Auskunftspflichtgesetzes – und somit außerhalb jeglicher öffentlichen Kontrolle. Auch dem Nationalrat teilte der Finanzminister in der Beantwortung einer parlamentarische Anfrage der NEOS mit: COFAG und ÖBAG, und damit der Vertrag der Austrian-Rettung, seien nicht vom parlamentarischen Fragerecht umfasst.
Bundesregierung: Förderungen/Corona-Hilfen
„Für die intransparente Handhabung der Corona-Hilfen und die intransparente Ausgestaltung der COFAG“
Es gibt keine zeitnahe Veröffentlichung, welche staatlichen Mittel aus welchen Corona Förder-Töpfen vergeben und ausbezahlt wurden. Keinerlei Nachvollziehbarkeit gibt es bei der Frage, welche Unternehmen und Organisationen welche staatlichen Hilfen erhalten haben. Öffentliche Nachvollziehbarkeit und Kontrolle wäre schon alleine aufgrund des riesigen Fördervolumens besonders wichtig, um eine effiziente Verwendung der Mittel sicherzustellen.
Die Schaffung einer eigenen Stelle für die Auszahlung von Corona-Hilfen ist nachvollziehbar. Transparenz über die Finanzierungen und eine parlamentarische Kontrolle werden jedoch verhindert, indem die Parteien zwar Vertreter in einen Beirat entsenden können, dieser Beirat jedoch kein Mitspracherecht hat, erst ab gewissen Finanzierungshöhen befasst wird und zu vollständiger Verschwiegenheit verpflichtet ist. Dieses Konstrukt befördert Misstrauen und behindert die Kontrolle durch Bürger, NGOs und das Parlament.
Auch die Auslagerung des Härtefallfonds an die Wirtschaftskammer ist eine Transparenzbremse, da die Wirtschaftskammer nur ihren eigenen Mitgliedern gegenüber Auskunftspflichtig ist. Außerdem werden durch dieses Konstrukt Unvereinbarkeiten geschaffen: Detaillierte Finanzdaten von Betrieben gelangen in die Hände der Wirtschaftskammer, wo in den Fachgruppen möglicherweise Konkurrenten der betroffenen Betriebe vertreten sind.
BMLV: Cyberdefense – Pressekonferenz-Aussagen sind für das Parlament geheim
“Für das Geheimhalten von Informationen, die Minister in Pressekonferenzen bekannt geben, gegenüber dem Parlament”
Der Neos-Abgeordnete Douglas Hoyos-Trauttmansdorff erkundigte sich in zwei parlamentarischen Anfragen nach der personellen Ausstattung der Cyber-Defense-Abteilung des BMLV. Ihm wurde vom BMLV mitgeteilt, dass ihm diese Informationen nicht mitgeteilt werden könnten, weil damit die nationale Sicherheit gefährdet werden würde.
Zwei Monate nach dieser Antwort verkündete das Bundesheer auf seiner Webseite, dass das Personal der Cyber-Defense von 20 auf 250 Personen aufgestockt werden wird.
Auf Anfrage nach Auskunftspflichtgesetz erklärt das Ministerium die verweigerte Aussageverweigerung so: “Da die parlamentarische Anfrage zu detailliert gestellt wurde und damit Rückschlüsse auf Personen, Organisationsdetails, Planungen, Einsätze etc. ermöglicht hätte und damit für potentielle Gegner (Hacker, fremde staatliche Akteure etc.) eine leichtere Einschätzbarkeit/Angreifbarkeit der IKT-Struktur des Bundesministeriums für Landesverteidigung (BMLV) gegeben wäre, hat sich das BMLV (nach reiflicher Abwägung) entschlossen sich in diesem Fall auf das Amtsgeheimnis zu berufen.”
| Die Frage Hoyos’ zur personellen Ausstattung (5.3.20): | Die Antwort des Ministeriums zur pers. Ausstattung (8.5.20): |
| Beabsichtigen Sie die personelle wie technische Ausstattung der Cyberdefence in Zukunft zu verstärken?
a. Wenn ja, wie und in welchem Ausmaß? Wie viele Planstellen sind für die kommenden Jahre vorgesehen? (Bitte um getrennte Darstellung nach Jahr.) |
Im Hinblick auf die Sensibilität dieses Bereiches ersuche ich aber um Verständnis, dass diese Fragen aus Gründen der Amtsverschwiegenheit im Interesse der Umfassenden Landesverteidigung (Art. 20 Abs. 3 B-VG) nicht geeignet sind, öffentlich erörtert zu werden und daher eine
inhaltlichen Beantwortung nicht möglich ist. |
| Die Frage Hoyos’ zur personellen Ausstattung (15.4.20): | Die Antwort des Ministeriums zur pers. Ausstattung (15.6.20): |
| Wie ist die Zusammenarbeit und Konstellation in Sachen Cyberabwehr mit dem BMI und dem BKA angedacht?
a. Welche aktuell vorhandenen Teams aus welchen Ministerien werden dafür zum Einsatz kommen? b. Ist geplant, zusätzliche Personen einzustellen? i. Wenn ja, für welche Positionen? |
Da für Personalmaßnahmen im Bereich der ÖSCS das Bundeskanzleramt zuständig ist, betreffen diese Fragen keinen Gegenstand der Vollziehung des BMLV. |
Auch das Ministerium (3.7.20): “Zur Cyber Defence wird gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt und dem Innenministerium ein Cybersicherheitszentrum auf dem neuesten Stand der Technik geschaffen. Die Ministerin plant hier eine massive Personalaufstockung von 20 auf 250 Personen durch Umschichtung von Planstellen.”
Innenministerium: Zuständigkeiten der Kabinetts-MitarbeiterInnen
“Für das Geheimhalten der Zuständigkeiten von Kabinetts-MitarbeiterInnen”
Während andere Ministerien auf ihrer Webseite transparent auflisten, wer im Kabinett der jeweiligen MinisterInnen arbeitet und wofür diese MitarbeiterInnen zuständig sind, verweigert das BMI die Herausgabe dieser Informationen. Begründet wird das mit “Besonderheiten der umfassenden Aufgabenstellungen des Bundesministeriums für Inneres “. Andere Ministerien haben diese Informationen auf ihrer Webseite öffentlich und transparent einsehbar.
Land Niederösterreich: Geheime Miete für eine ÖVP-nahe Werbeagentur im NÖ Landhaus
“Für Intransparenz bei der Vermietung öffentlichen Eigentums”
Im Gebäude des niederösterreichischen Landhauses in St. Pölten haben sich neben Bundes- und Landeseigenen Unternehmen und Stellen auch eine Werbeagentur sowie ein mit ihr verbundener Verlag (gleiche Eigentümer und Geschäftsführer, zum Teil gleiche MitarbeiterInnen), der mehrere ÖVP-Mitgliederzeitungen herausgibt, eingemietet.
Auf eine Anfrage durch NEOS im niederösterreichischen Landtag nach den Mietkonditionen für die dort ansässigen Unternehmen lautete die Antwort durch die Landeshauptfrau, dass die Konditionen für alle Mieter gleich wären, sich an der Marktlage orientieren würde – und dem Datenschutz unterliege. Dass der Vermieter im Eigentum der öffentlichen Hand ist sei dabei irrelevant.